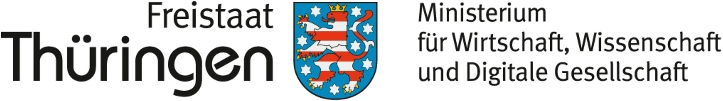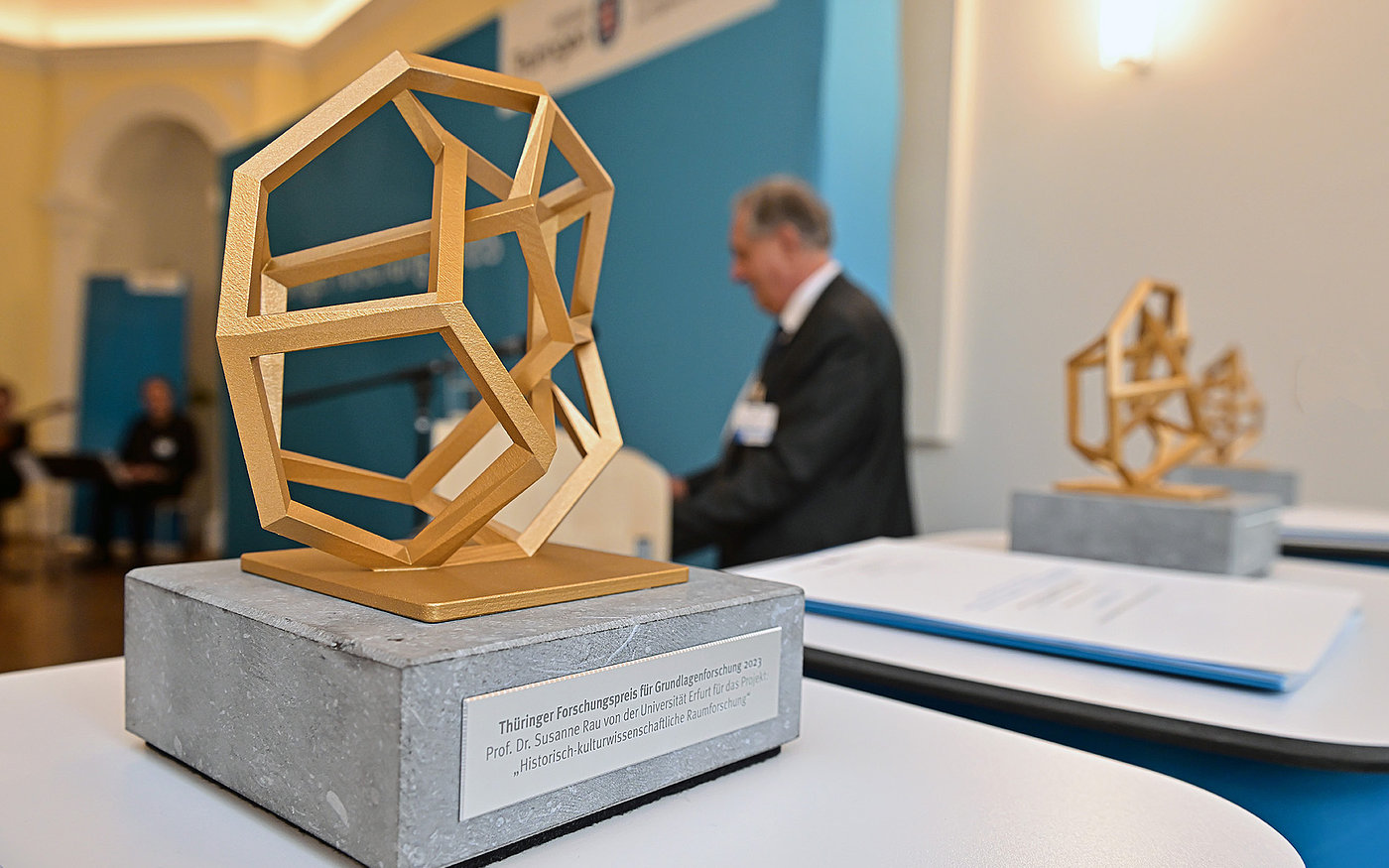Exzellente Forschung in Thüringen
Mit dem Thüringer Forschungspreis ehrt der Freistaat seit 1995 einmal im Jahr wissenschaftliche Spitzenleistungen der Thüringer Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Mehr als 240 Forscherinnen und Forscher wurden seitdem geehrt. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus anerkannten Wissenschaftlern aus ganz Deutschland.
Die exzellentesten Forschungsleistungen von Einzelpersonen oder Forschergruppen in den Kategorien der Grundlagen- und der angewandten Forschung werden mit einem Preisgeld von insgesamt 50.000 € und dem Forschungspreis-Award prämiert.
Einreichungen 2024
Thema: Menschheitsgeschichte in den Tropen und ihre Relevanz für die Gegenwart
Kategorie: Grundlagenforschung
Institution: Max-Planck-Institut für Geoanthropologie
Forschende: Dr. Patrick Roberts
Die tropischen Wälder sind für die Zukunft unserer Spezies von entscheidender Bedeutung. Bis 2050 werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in den Tropen leben, für ihre Ernährung, ihre Ressourcen und ihre Sicherheit werden die Menschen auf die dortigen Wälder angewiesen sein. Die tropischen Wälder beherbergen mehr als die Hälfte der biologischen Vielfalt der Erde, sie beeinflussen das Klimasystem und sind für den Kohlenstoffkreislauf von entscheidender Bedeutung. Deshalb sind sie einer der großen Schwerpunkte der gegenwärtigen Bemühungen, das Anthropozän – das menschengemachte Erdzeitalter – nachhaltig auszurichten. Die lokalen und regionalen Auswirkungen der durch den Menschen hervorgerufenen Veränderungen auf diese Lebensräume haben Rückkopplungen, die weit über die Tropen hinausgehen, was selbst die Bemühungen, die Kohlendioxidemissionen einzudämmen und die postindustrielle Erwärmung unter 2,0 °C zu halten, betrifft. Um diese aktuellen Herausforderungen zu verstehen und gerechte, nachhaltige Lösungen zu finden, gilt es die langfristigen Beziehungen zwischen unserer Spezies und den tropischen Wäldern verstehen.
In der westlichen Literatur und in Filmen werden diese Lebensräume oft als "wild" oder außerhalb der menschlichen Erfahrung dargestellt, man denke nur an das "Dschungelbuch". Wir lassen uns gerne von tropischen Dokumentarfilmen beeindrucken, aber es fällt uns schwer, eine tiefe Verbindung zu den Tropenwäldern herzustellen oder in ihrem Interesse zu handeln. Die Forschungsgruppe von Dr. Patrick Roberts hat in den letzten sieben Jahren die neuesten Methoden angewandt – vom Laserscanning aus der Luft zur Untersuchung menschlicher Spuren am Boden bis hin zur Analyse der genetischen Informationen von Pflanzen, um menschliche Interaktionen mit verschiedenen Arten aufzudecken und um neue Einblicke in die menschliche Geschichte zu erhalten.
Thema: Paläomoleküle – Wirkstoffsuche in der zeitlichen Dimension
Kategorie: Grundlagenforschung
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena unterstützt durch Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie Hans-Knöll-Institut Jena
Forschende: Prof. Dr. Pierre Stallforth (Sprecher), Prof. Dr. Christina Warinner, Dr. Martin Klapper, Dr. Alexander Hübner, Dr. Anan Ibrahim
Aus Zehntausende Jahre alter, zerstückelter DNA haben Forschende in Jena das Genom unbekannter Bakterien rekonstruiert und ein prähistorisches Molekül wiederhergestellt.
Bakterien bilden zahlreiche Naturstoffe, darunter Antibiotika und andere therapeutische Wirkstoffe. Da sie die Erde seit mehr als drei Milliarden Jahren besiedeln, wird in ausgestorbenen Bakterien eine enorme Vielfalt an Naturstoffen mit Anwendungspotenzial vermutet.
Das Team isolierte die genetische Information steinzeitlicher Mikroorganismen aus fossilem Zahnstein von Neandertalern und modernen Menschen. Mit großem Aufwand konnte die stark zerstückelte DNA der prähistorischen Mundhöhlenflora in größere Fragmente zusammengesetzt werden. Diese wurden nach Bauplänen für Naturstoff-Syntheseenzyme durchmustert. Ein besonders gut erhaltenes bakterielles Genom wurde aus dem Zahnstein der etwa 19.000 Jahre alten „Roten Dame von El Mirón“ rekonstruiert, deren Skelett 2010 in einer spanischen Höhle gefunden wurde.
Es gelang dem Team weltweit erstmals, die steinzeitlichen Gene in lebenden Bakterien zu reaktivieren und die neue Naturstoff-Familie der Paläofurane zu entdecken. Damit wurde der Grundstein gelegt, um die verborgene chemische Vielfalt der Mikroben der Erdgeschichte zu erschließen.
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena widmet sich gemeinsam mit den außeruniversitären Instituten in Jena der Erforschung von Naturstoffen, die für die Anwendung, beispielsweise als Antibiotika, in Betracht kommen. Gebündelt wird diese Forschung im Exzellenzcluster Balance of the Microverse. Vor diesem Hintergrund hat das Forschungsteam einen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt, der international für erhebliche Furore sorgte und die Tür zu neuen, dringend benötigten Wirkstoffen weit aufstößt. Das Team arbeitet an der Reaktivierung prähistorischer Naturstoffe aus DNA-Bruchstücken, die in fossilen Materialien vorkommen.
Thema: Partizipative Erinnerungsforschung als innovative Methode der Erfahrungsgeschichte
Kategorie: Grundlagenforschung
Institution: Universität Erfurt
Forschende: Prof. Dr. Christiane Kuller
Wie erinnern, verarbeiten und erzählen Menschen persönliche Erlebnisse in der jüngeren Geschichte? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Forschung der Zeithistorikerin Christiane Kuller im Forschungsverbund „Diktaturerfahrung und Transformation“ und in der daraus hervorgegangenen Oral-History-Forschungsstelle an der Universität Erfurt, die den Übergang von diktatorischen zu postdiktatorischen Regimen untersucht. Für das Verständnis solcher Übergangsphasen in Deutschland, in Europa, aber auch in anderen Weltregionen sind erfahrungsgeschichtliche Zugänge zentral. Denn nicht selten stehen die persönlichen Erinnerungen in einem Spannungsverhältnis zu öffentlichen Vergangenheitsbildern – ein Thema, über das auch in der deutschen Gesellschaft aktuell lebhaft gestritten wird. Zeitgeschichtliche Forschung muss solche Widersprüche ernst nehmen und auch erfahrungsgeschichtliche Narrative in die Analyse und Interpretation historischer Zusammenhänge einbeziehen. Das Forschungsprojekt von Christiane Kuller tut dies über lebensgeschichtliche Interviews mit den Methoden der Oral History.
Dabei steht die Oral History zum einen vor der Herausforderung, ihre Methoden, die in Deutschland in der Endphase des Kalten Krieges und unter den Rahmenbedingungen einer spezifischen westdeutschen Erinnerungskultur zur Untersuchung der NS-Diktatur entwickelt wurden, an die Forschung zu (post)sozialistischen Gesellschaften anzupassen. Hinzu kommt, und darauf zielt der innovative partizipative Kern der Forschungen von Christiane Kuller, dass sich die traditionelle Rolle wissenschaftlicher Forschung in der Gesellschaft gerade stark verändert: Forschung muss sich für gesellschaftliche Mitwirkung öffnen, wenn sie in der Gesellschaft Anerkennung finden will.
Hier setzt die partizipative Erinnerungsforschung an, die auf Transparenz des Forschungsprozesses und die Partizipation einer interessierten Öffentlichkeit zielt. Sie fordert den gesellschaftlichen Dialog in allen Phasen des Forschungsprozesses – von der Projektkonzeption über die Methodendiskussion und die Durchführung der Untersuchung bis hin zu Ergebnisformulierung und -vermittlung. Dieser Dialog wirkt auf der einen Seite in die wissenschaftliche Forschung hinein, indem innovative und gesellschaftlich relevante Fragen generiert werden; gleichzeitig entsteht durch den Austausch in der Gesellschaft ein Verständnis für und eine Akzeptanz von wissenschaftlicher Forschungsarbeit. Die Forschung von Christiane Kuller greift mit ihrem partizipativen Ansatz Forderungen nach einer gesellschaftlich verantwortungsbewussten, ethisch reflektierten und partizipativ legitimierten wissenschaftlichen Forschung auf und erprobt die konkrete Umsetzung im Bereich der Oral History. Ausgehend von einer spezifisch zeithistorischen Forschungsperspektive ist die Forschung in breite interdisziplinäre und internationale Netzwerke eingebunden, um auch eine Methodendiskussion über Fächergrenzen hinweg zu initiieren.
Thema: Maßgeschneiderte 2D-Materialien für photonische, elektronische und optoelektronische Anwendungen
Kategorie: Angewandte Forschung
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Andrey Turchanin (Sprecher), Dr. Antony George, Dr. Falk Eilenberger, Dr. Christof Neumann
Atomar dünne, zweidimensionale (2D) Materialien sind eine neue und sich rasant entwickelnde Materialklasse. Diese Quantenmaterialien bestehen aus nur einer oder wenigen atomaren Lagen – einem Hauch von nichts; hunderttausendmal dünner als ein menschliches Haar. Trotz ihrer Winzigkeit haben sie einzigartige physikalische und chemische Eigenschaften, was sie vielversprechend für die Entwicklung von neuen Technologien macht. Forscher der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben neue Methoden entwickelt, diese Materialien in die Anwendung zu überführen. Sie haben eine Reihe von technologischen Prozessen gefunden, um 2D-Materialien maßzuschneidern und sie mit industriekompatiblen Verfahren herzustellen. So wurden erstmals elektronische, photonische und optoelektronische Bauelemente hergestellt, die gleichzeitig extrem klein und leistungsfähig sind.
Zu den wichtigsten Durchbrüchen gehören die Erzeugung von atomar dünnen und scharfen p-n-Übergängen, die Synthese von sogenannten Janus-Monoschichten sowie die Integration von 2D-Materialien in Nano-Transistoren, Wellenleitern, Photodetektoren und Li-Metall-Batterien. Diese Fortschritte ebnen den Weg für die technische Weiterentwicklung von Mikro-elektronik mit schnellen und energiesparsamen Prozessoren und Datenspeichern, Quanten-computern and Quantenkommunikation.
Darüber hinaus konnten die Forscher auch zeigen, dass 2D-Materialien unmittelbar in um-weltfreundlichen Technologien zum Einsatz kommen können: als Filter für die Aufbereitung von sauberem Wasser, als mikroskopische Sensoren für Chemikalien, für die Herstellung von effizienteren Katalysatoren, sowie in noch langlebigeren und nicht brennbaren Batteriespeichern mit hoher Energiedichte.
Die Arbeiten von Herrn Prof. Andrey Turchanin und seinem Team um Herrn Dr. Antony George, Herrn Dr. Falk Eilenberger, Herrn Dr. Christof Neumann sind vornehmlich in der Arbeitsgruppe „Angewandte Physikalische Chemie und Molekulare Nanotechnologie“ am Institut für Physikalische Chemie der Friedrich-Schiller-Universität Jena durchgeführt worden. Die Arbeitsgruppe befasst sich in ihren Forschungsschwerpunkten mit der Herstellung von neuartigen 2D-Materialien, ihrer Untersuchung mit modernsten spektroskopischen und mikroskopischen Methoden sowie Ihrer Integration in die innovativen industriekompatiblen Bauelemente. Hierbei decken die Forscher die gesamte Wertschöpfungskette vom grundlegenden mechanistischen und detaillierten Verständnis der Herstellungsprozesse der Materialien, bis hin zur Realisierung und Erprobung von technischen Prototypen, ab.
Thema: Parasitäre Konvektionsströmungen – Die „DNA“ des thermischen Schichtenspeichers
Kategorie: Angewandte Forschung
Institution: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Prof. Dr.-Ing. Christian Cierpka (Sprecher), M.Sc. Otto Henning, M.Sc. Clemens Naumann
Energiespeicher für Carnot-Batterien
Das Konzept einer Carnot-Batterie klingt aus thermodynamischer Sicht zunächst sonderbar, da hochwertige elektrische Energie umgewandelt und in Form von Wärmeenergie gespeichert wird. Diese kann später nur zum Teil in elektrische Energie mittels Wärmekraftmaschinen (Dampfkraftwerke) zurückgewandelt werden. Nutzt man aber eine Wärmepumpe, kann mit der zur Verfügung stehenden elektrischen Energie deutlich mehr Wärme aus der Umgebung gewonnen und gespeichert werden. Der geringe Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine kann theoretisch voll ausgeglichen werden. Das große Potenzial liegt darin, dass thermische Energie in großem Maßstab, preiswert, sicher und für die Umwelt unbedenklich gespeichert werden kann. Die Technologie lässt sich mit bestehenden Dampfkraftwerken kombinieren, indem der Dampferzeuger mit der gespeicherten Wärmeenergie betrieben wird. Damit wird erneuerbare Energie grundlastfähig und es können durch die Nutzung bestehender Kraftwerke enorme Kosten eingespart werden. Eine Schlüsselkomponente ist dabei der Speicher, welcher möglichst viel Wärmeenergie möglichst lange speichern muss. Aufgrund der hohen Wärmekapazität kommen hier Flüssigkeiten wie Wasser oder Salzschmelzen, häufig in Form von Schichtenspeichern, zum Einsatz.
Das Forscherteam hat bisher gezeigt, dass solche Speicher deutlich komplexer sind als der einfache Aufbau vermuten lässt. Selbst wenn die Energieverluste nach außen durch geeignete Isolation minimiert werden, kommt es aufgrund der oft deutlich höheren Wärmeleitfähigkeit in den Speicherwänden zu Wärmeströmen. Dadurch wird wandnahe Flüssigkeit im kalten Bereich erwärmt und steigt aufgrund des Dichteunterschiedes auf. Im warmen Bereich wird die wandnahe Flüssigkeit abgekühlt und sinkt ab. Diese beiden Wandströmungen treffen in der Thermokline aufeinander und sorgen für komplexe Strömungsmuster, welche das Speichermedium kontinuierlich mischen. Damit wird die Arbeitsfähigkeit (der Anteil nutzbarer Energie für die Stromerzeugung) stark reduziert. Am Fachgebiet Technische Thermodynamik entwickeln wir moderne laseroptische Messtechniken wodurch die thermodynamischen und strömungsmechanischen Phänomene in thermischen Schichtenspeichern erstmals detailliert beschreiben und verstanden werden können. So konnten wir nachweisen, dass die Wandstrahlen turbulent werden können und weitere Strömungsinstabilitäten mit charakteristischen Frequenzen im Speicher anfachen. Diese Effekte nehmen für große Speicher in ihrer Intensität zu und müssen für effiziente Speicher minimiert werden. Unsere Ergebnisse können direkt zu Verbesserungen beitragen, um mit einfachen Maßnahmen die Speichereffizienz zu erhöhen.
An der TU Ilmenau sollen gemeinsam mit anderen Forschenden im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Schwerpunktprogramms „Carnot-Batterien: Inverser Entwurf vom Markt bis zum Molekül“, interdisziplinär die Grundlagen für zukünftige großtechnische Anlagen geschaffen werden. Dazu sollen die Techniken weiterentwickelt und in innovativen Salzschmelzenspeichern eingesetzt werden, um zukünftig die Effizienz solcher Systeme genau vorhersagen und optimieren zu können.
Preisträger der vergangenen Jahre
Instution: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Prof. Jörg Kröger
Kategorie: Grundlagenforschung
Quantenphysik live!
Modernste Rastersondenmikroskope ermöglichen den Zutritt zum Nanokosmos. Durch die atomar präzise Bildgebung ist die Quantenwelt unserer Anschauung direkt zugänglich. Damit verlieren Konzepte wie jenes der Materiewelle ihren abstrakten Charakter, da Elektronenwellen rastertunnelmikroskopisch direkt sichtbar sind. Der Nanokosmos ist darüber hinaus im wahren Sinne des Wortes greifbar. Die Spitzen der Mikroskope dienen als probate Werkzeuge, um artifizielle Strukturen – Nano-Laboratorien – Atom für Atom zu konstruieren. Dies ist für die Grundlagenforschung in Physik von höchster Bedeutung: An modellhaften Systemen ist der Erkenntnisgewinn maximal, da sich Mechanismen und Prinzipien der Quantenphysik ableiten lassen, die auch für komplexere Aufbauten gelten. Es ist sogar möglich, die Spitzen durch Anlagerung einzelner Atome oder Moleküle in empfindliche Sensoren zu verwandeln. Damit untersucht man Supraleitung durch molekulare Stromkreise, die in zukünftigen Rechnerarchitekturen oder neuromorphen Schaltungen bedeutsam sind. Reaktive Zentren biologisch und chemisch relevanter Moleküle werden anhand dieser Spitzen mit atomarer Auflösung identifiziert. Die Konzeption und Herstellung funktioneller Moleküle etwa für die Nanomedizin lässt sich durch derart speziell präparierte Mikroskopsonden unterstützen. Schließlich bringen Rastersondenmethoden einzelne Moleküle zum Leuchten und weisen einen neuartigen Weg in die Informations- und Verschlüsselungstechnologie auf. Die Quanten sind nicht länger ein „Akt der Verzweiflung‟, wie Max Planck sie bei ihrer Einführung in die Physik bezeichnete, sondern vielmehr ein erhellender Blick in die Zukunft.
Instution: Universität Erfurt
Forschende: Prof. Dr. Susanne Rau
Kategorie: Grundlagenforschung
Wir verstehen Gesellschaften besser, wenn wir ihre räumlichen Dimensionen analysieren und ihre historische Entwicklung beleuchten. Dies gilt für vergangene Gesellschaften, die unsere Gegenwart mitprägen, wie auch für heutige fremde Kulturen, mit denen wir in Beziehung stehen – sei es durch Handel, Reisen, Migration oder Vergleiche und Bewertungen.
Susanne Rau, Professorin für „Geschichte und Kulturen der Räume in der Neuzeit“, hat die Kategorie ‚Raum‘ für die Analyse historischer Gesellschaften fruchtbar gemacht und damit der Geschichtswissenschaft einen sichtbaren Platz in der bis dato sozialwissenschaftlich geprägten Debatte gegeben. Darauf aufbauend hat sie eine Methode zur Erforschung historischer Räumlichkeiten, die auch Zeitlichkeiten und Dynamiken mitdenkt, grundständig entwickelt und damit die spezifisch historisch-kulturwissenschaftliche Raumforschung maßgeblich etabliert. Diese Methode, die sie in einem dialektischen Prozess von historischen Quellenstudien und kritischer Auseinandersetzung mit Raumtheorien entwickelte, hat zu einem neuen Verständnis der Raumvorstellungen und -praktiken in Städten seit dem späten Mittelalter geführt.
Ihre Forschungsleistung besteht darüber hinaus in der Anwendung und Diffusion dieser Methode in der Geschichtswissenschaft (Stadt-, Kartographie-, Handels- und Religionsgeschichte) sowie in der interdisziplinären und internationalen Zusammenarbeit. Diese zeigt sich in mehreren Projekten wie der am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt angesiedelten Kolleg-Forschungsgruppe „Religion und Urbanität“ mit ihren bis dato über 50 Fellows aus der ganzen Welt, die Erfurt zu einem Ort für internationale Spitzenforschung gemacht haben.
Instution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Benjamin Dietzek-Ivanšić, Dr. Linda Zedler (IPHT), Dr. Carolin Müller (Université du Luxembourg)
Kategorie: Angewandte Forschung
Das unsichtbare sichtbar zu machen, und den flüchtigen Augenblick festzuhalten, das ist Forschern der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit ihren Verfahren der zeitaufgelösten Absorptionsspektroelektrochemie und in operando Absorptionsspektroskopie gelungen. Im Rahmen ihrer Arbeit zur Erforschung neuartiger Verfahren zur umweltfreundlichen und emissionsfreien Produktion und Speicherung erneuerbarer Energien haben die Forscher erfolgreich ein optisches Messverfahren entwickelt, das erstmalig die dabei ablaufenden chemischen Reaktionen entlang der gesamten Prozesskette detailliert untersuchen kann, um z.B. die Effizienz zu steigern. Die Schlüsselrolle bei der Umwandlung und chemischen Speicherung stellen sogenannte Katalysatoren dar. Das sind Stoffe, die chemische Prozesse stark beschleunigen und aus praktisch allen relevanten chemischen Verfahren nicht wegzudenken sind. Bisher werden solche Katalysatoren durch Versuch-und-Irrtum optimiert. Das Verfahren der Jenaer Forscher erlaubt es nun, die Funktionsweise von der Natur inspirierter artifizieller Photokatalysatoren zu beobachten. Hier treten kurzlebige Zwischenprodukte auf, deren Eigenschaften und Reaktionen entscheidend für den Gesamtprozess sind und die sich nun erstmals untersuchen lassen. Die Verfahren der zeitaufgelösten Absorptionsspektroelektrochemie und in operando Absorptionsspektroskopie sollen in Zukunft auch zur Erforschung Licht-getriebener Prozesse für die CO2-Speicherung zur Reduzierung von Treibhausgasen eingesetzt werden und versprechen vielfältige Einblicke in die Welt des Unsichtbaren.
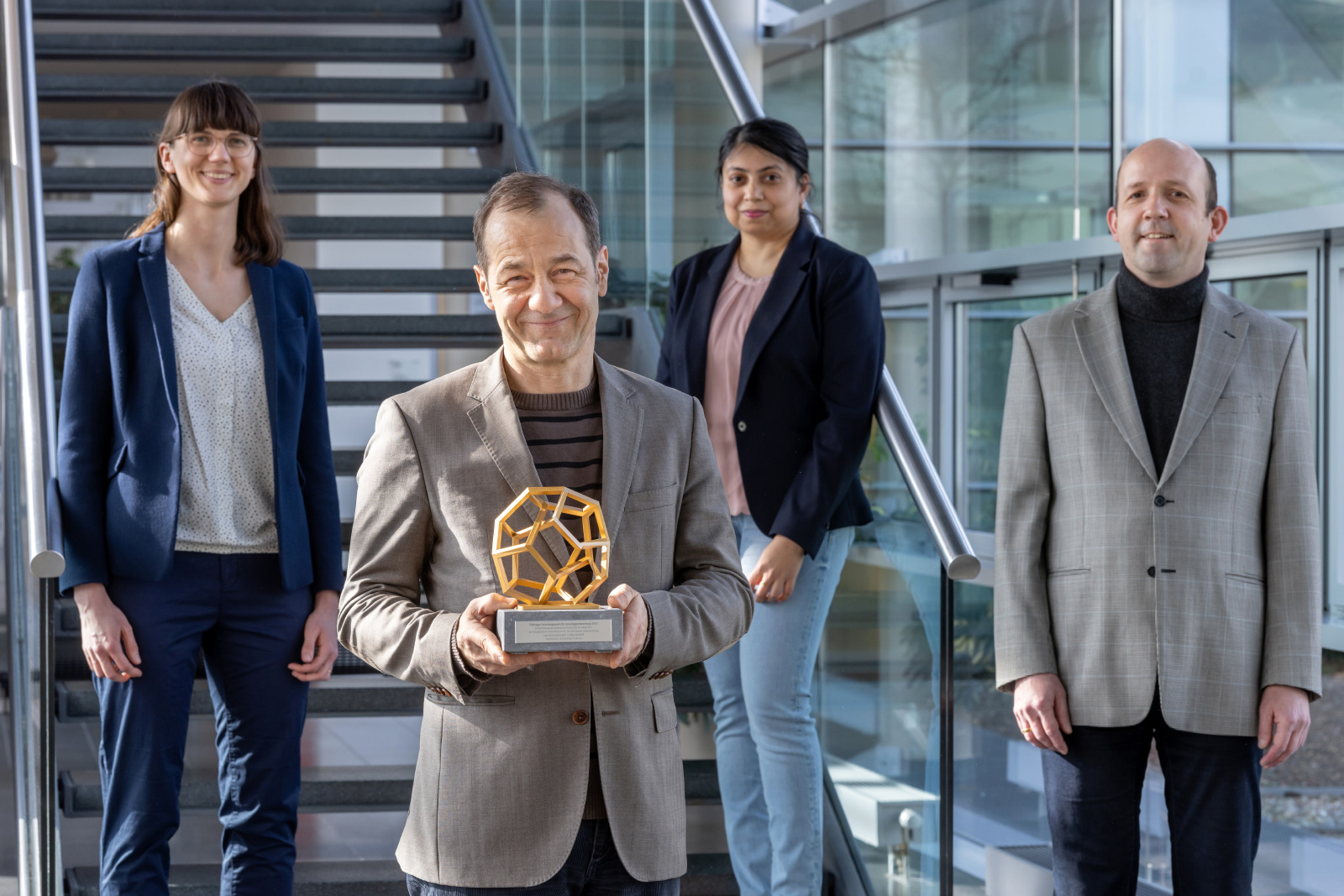
Institution: Technischen Universität Ilmenau
Forschende: Prof. Dr. Thomas Hannappel (Sprecher), Dr. Agnieszka Paszuk, Dr. Oliver Supplie, M. Sc. Manali Nandy, Dr. Peter Kleinschmidt
Das Verständnis, die Integration und das Wachstum von III-V-Halbleitern auf Silizium war schon für den Thüringer Nobelpreisträger Herbert Krömer von essentieller Bedeutung. Er hat die Redewendung geprägt "the interface is the device": die Grenzfläche ist maßgeblich für das gesamte Bauelement. Die Aufklärung der mikroskopischen Struktur an dieser kritischen Grenzfläche zwischen den beiden bedeutenden und unterschiedlichen Halbleitern und deren erfolgreicher Einsatz ist nicht nur für die direkte solare Brennstofferzeugung, die sogenannte künstliche Photosynthese, von höchster Relevanz, sondern für die gesamte Optoelektronik.
Die Arbeiten der Forschergruppe zur Entwicklung dieser Grenzfläche haben bereits maßgeblich zu Solarzellen-Rekordergebnissen, Netzwerkprojekten, Patenten und einer beachtlichen Anzahl an Veröffentlichungen beigetragen. Dieses Thema zieht sich durch Forschungsarbeiten der vergangenen Jahre bis heute. Dabei wird eine entscheidende Originalität in der Vorgehensweise genutzt: Mit Hilfe sogenannter optischer in situ-Spektroskopie werden die kritische Grenzflächenstruktur während des äußerst komplexen Wachstumsprozesses auf atomarer Skala durchleuchtet. Damit gelang schließlich in einer kürzlich veröffentlichten Weiterentwicklung der III-V/Silizium-Grenzflächenpräparation eine deutliche Verbesserung der Materialqualität-Ausgangspunkt für die Entwicklung künftiger wettbewerbsfähiger Hochleistungs-Bauelemente, insbesondere für die solare Wasserstofferzeugung.

Institution: Universität Erfurt
Team: Philipp Sprengholz, Georg Meyer-Hoeven, Sabine Altwein, Prof. Dr. Cornelia Betsch, Frederike Taubert, Gbadebo Collins Adeyanju (v.l.n.r.)
Untersucht wird die Forschungsfrage, welche Rolle menschliches Verhalten bei der Ausbreitung von Infektionskrankheiten spielt. Was Menschen wissen, was sie glauben, wie sie sich schützen – all dies beeinflusst die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, wie zuletzt in der Corona Pandemie deutlich wurde. Aufbauend auf früheren Erkenntnissen hat Prof. Betsch mit ihrem Team (Philipp Sprengholz, Lars Korn, Lisa Felgendreff, Sarah Eitze, Frederike Taubert) an der Universität Erfurt ein regelmäßiges Psychogramm der Corona Pandemie gezeichnet. Im COVID-19 Snapshot Monitoring COSMO wurden über 50.000 Personen befragt. Je nach politischer und gesellschaftlicher Lage wurden die Befragungen so angepasst, dass Einsichten in aktuelle Themen der Pandemiebewältigung möglich wurden.
Durch die sofortige online Veröffentlichung aktueller Ergebnisse entwickelte sich das Projekt in Politik und Medien schnell zu einer wichtigen Referenz, um gesellschaftliche Diskussionen und politische Entscheidungen zu unterstützen. Die Ergebnisse wurden in renommierten Fachzeitschriften publiziert und international rezipiert. Zu Beginn der Pandemie wurde z.B. die Frage untersucht, welche psychologischen Folgen eine Maskenpflicht haben und wie sie sich auf unser soziales Handeln auswirken könnte.
Auch bei der Einführung von Schnelltests wurde untersucht, wie Gesundheitskommunikation gestaltet werden muss, damit Schnelltests erfolgreich zur Pandemiebewältigung eingesetzt werden können. Mit zahlreichen Arbeiten im Bereich der Impfentscheidung und zu psychologischen Folgen einer Impfpflicht hat Prof. Betsch den deutschen Diskurs zur Corona-Impfung und bereits 2017 zum Masern-schutzgesetz mitbestimmt. Eine Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation ermöglichte es, in ca. 40 Ländern Studien nach diesem Vorbild durchzuführen.
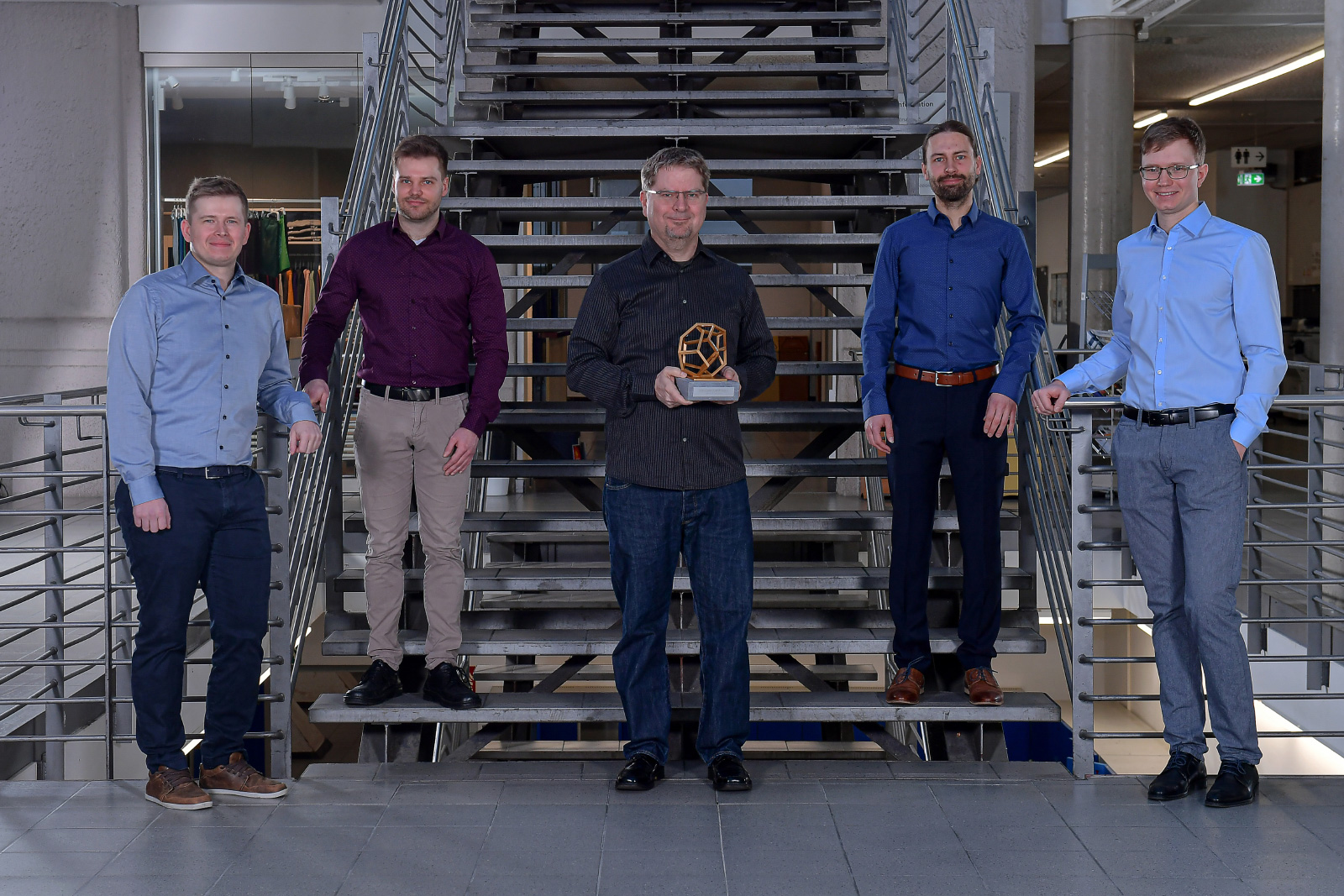
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Dr. Markus Fleischauer, Dr. Kai Dührkop, Prof. Dr. Sebastian Böcker, Dr. Marcus Ludwig, Martin Hoffmann (v.l.n.r.)
Kleine Moleküle sind allgegenwärtig: sie machen krank (Umweltforschung) oder gesund (Pharmazie), sie dienen als Bausteine von Proteinen und DNA, und ohne sie ist kein Leben möglich. Ihre strukturelle Vielfalt ist gigantisch. Ihr Nachweis erfolgt üblicherweise durch Massenspektrometrie, doch ist die Interpretation der Daten zu ihrer Identifizierung äußerst komplex.
Zur Auswertung dieser Daten und zur Annotation kleiner Moleküle entwickelt die Gruppe von Prof. Böcker neue Verfahren der künstlichen Intelligenz, aber auch der kombinatorischen Optimierung und des Operations-Research. Eine Methode erlaubt es, ähnlich einer Internetsuchmaschine, mit den Daten in einer Strukturdatenbank zu suchen; eine andere, für noch gänzlich unbekannte kleine Moleküle, Stoffklassen zu bestimmen. Diese Methoden sind weltweit führend für die Aufgaben.
Hervorzuheben ist die starke internationale Vernetzung der Gruppe mit renommierten Theoretikern als auch Praktikern und die erfolgreiche Translation von komplexen Algorithmen in robuste, nutzerfreundliche Software und Webservices basierend auf hochskalierbarer Infrastruktur.
Die Services werden weltweit rege genutzt, mit mehr als 160 Millionen bearbeiteten Anfragen aus 69 Ländern. Die Software SIRIUS wurde 2020 von Nature Methods als "method to watch" ausgezeichnet. Das Interesse globaler Firmen resultierte in der Ausgründung der Bright Giant GmbH, die als Lizenznehmerin der FSU Jena kommerzielle Services zu diesen Fragestellungen anbietet.
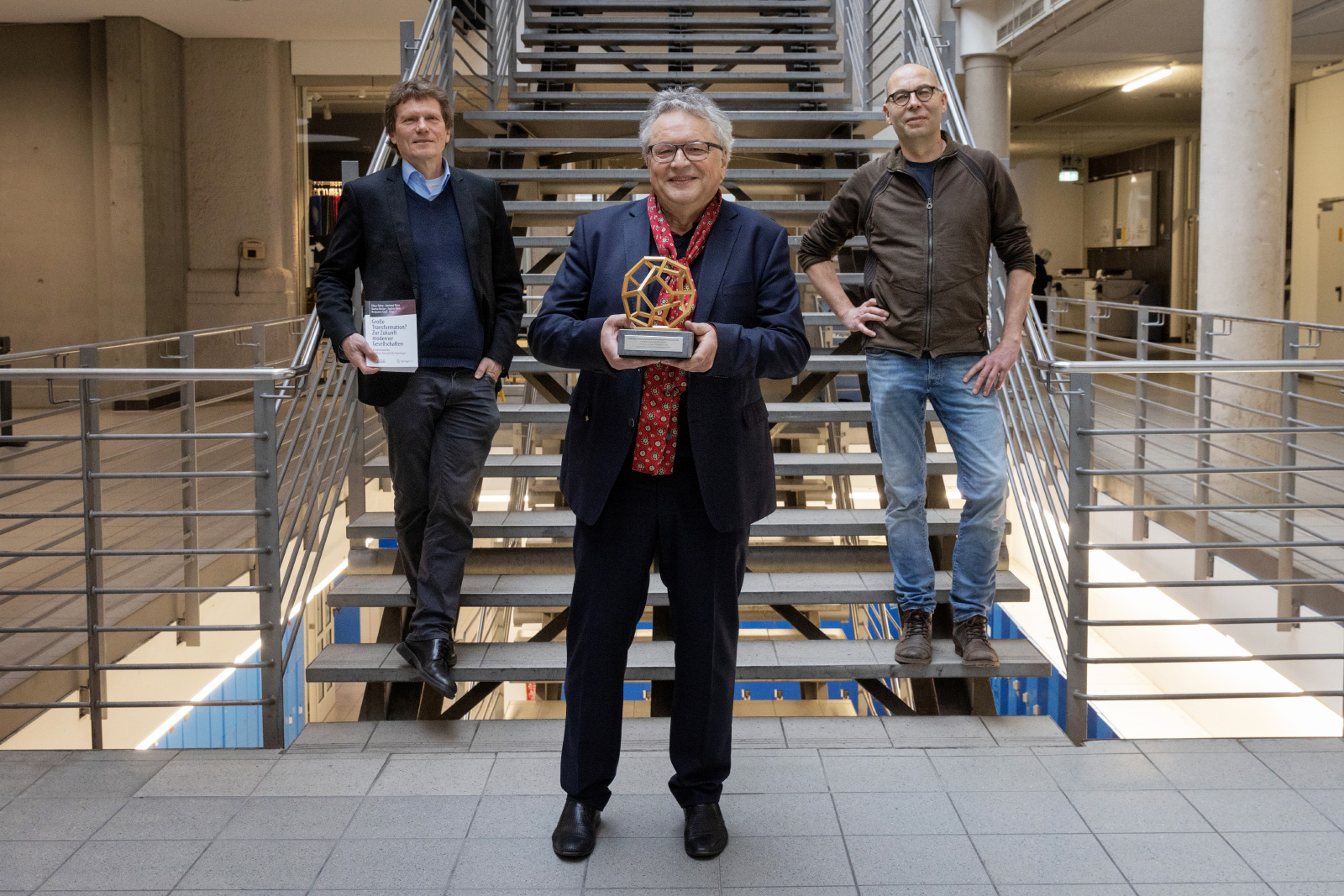
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Ludwig-Maximilians-Universität München
Forschende: Prof. Dr. Klaus Dörre, Prof. Dr. Hartmut Rosa (Jena), Prof. Dr. Stephan Lessenich (München)
Die Professoren Klaus Dörre, Stephan Lessenich und Hartmut Rosa sind die Initiatoren der DFG-Kollegforschungsgruppe „Landnahme, Beschleunigung, Aktivierung. Zur (De-)Stabilisierung moderner Wachstumsgesellschaften“. Ihre zentrale Arbeitsthese lautet: Moderne kapitalistische Gesellschaften, die sich nur durch rasches, permanentes Wachstum stabilisieren können, sind in eine langwierige und historisch neuartige ökologisch-ökonomische Zangenkrise geraten. Zwar wird über die Grenzen des Wachstums seit langem diskutiert, neu ist jedoch, dass der Transformationsdruck mittlerweile die nationalen Wirtschaftsmodelle und mit ihnen auch den Alltag der Menschen erreicht hat.
Ziele wie das einer vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050 zwingen die frühindustrialisierten Länder zu dramatischen Veränderungen ihrer Produktions- und Lebensweisen. Sie stehen vor einer „Nachhaltigkeitsrevolution“ (Dörre). Je länger sie sich damit begnügen, die sozialen und ökologischen Kosten ihres Wohlstands zu „externalisieren“ (Lessenich), desto rascher „schrumpft ihre Zukunft“ (Rosa), sprich: die Zeit, die für eine Wende zur Nachhaltigkeit noch bleibt. Das Kolleg ergeht sich aber nicht in apokalyptischen Szenarien. Seine Arbeiten beginnen dort, wo naturwissenschaftliche Expertise endet. Dörre, Lessenich und Rosa untersuchen die strukturellen Wachstumszwänge moderner Gesellschaften, um sodann in experimentellen Verfahren potentielle Alternativen auszuloten. Ausgangspunkt der Forschungen sind die Dynamisierungsimperative Landnahme (Dörre), Beschleunigung (Rosa) und Aktivierung (Lessenich), die systematisch mit Gegenbegriffen wie sozial-ökologische Nachhaltigkeit, Resonanz und Solidarität kontrastiert werden.
Die Forschungsleistung des Kollegs besteht vor allem darin, die sozialen Mechanismen eines „Immer mehr und nie genug“ systematisch untersucht zu haben. Dank der Arbeit des Kollegs weiß man heute nicht nur in der Soziologie: Wirtschaftswachstum, das auf hohem Energie- und Ressourcenverbrauch sowie auf steigenden Emissionen beruht, ist Teil des Problems, nicht seiner Lösung. Vor allem aber ist nun bekannt, welche ökonomischen, sozialen und kulturellen Wachstumstreiber wirken. Geklärt ist, woraus systemische Steigerungszwänge resultieren, welche Mechanismen sie in Gang setzen und wie die gesellschaftlichen Folgen aussehen. Auf der Grundlage einer solchen Analyse gelingt es Dörre, Lessenich und Rosa, exemplarisch Auswege aus der Zangenkrise zu erkunden und Umrisse demokratischer Postwachstumsgesellschaften zu skizzieren.

Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Universität Halle, Universität Leipzig
Forschende: Prof. Dr. Stefan Lorkowski, Dr. Christine Dawczynski (Jena), Prof. Dr. Gabriele Stangl, Dr. Toni Meier (Halle), Prof. Dr. Peggy Braun, Dr. Tobias Höhn, Dr. Claudia Wiacek (Leipzig)
Die weltweit häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen; mehr als vier Millionen Menschen sterben jährlich in Europa an deren Folgen. Dabei hätte jeder zweite bis dritte vorzeitige Todesfall durch eine ausgewogene Ernährung vermieden werden können, wie die Wissenschaftler des Kompetenzclusters für Ernährung und kardiovaskuläre Gesundheit (nutriCARD) Halle-Jena-Leipzig aufzeigen. Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt nutriCARD hat sich zum Ziel gesetzt, die Ernährungsweise der Bevölkerung umfassend und nachhaltig zu verbessern.
Dafür arbeiten unter der Koordination von Prof. Dr. Stefan Lorkowski mehr als 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche der Universitäten Jena, Halle-Wittenberg und Leipzig in Kooperation mit rund 80 außeruniversitären Partnern eng zusammen. Ein lebendiges und produktives Netzwerk wurde geschaffen, das die nationale sowie internationale Sichtbarkeit der Ernährungsforschung im mitteldeutschen Raum erhöht, aber auch mehrere tausend Menschen für eine bessere Ernährung sensibilisiert hat.
Dabei wird ein translationaler Ansatz verfolgt: Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung werden in optimierte Rezepturen von Lebensmitteln und Ernährungskonzepte sowie neue Lebensmittel überführt und mittels innovativer Ansätze in der Kommunikation für Verbraucher verständlich und im Alltag nutzbar aufbereitet. Langfristig möchte nutriCARD seine Kompetenzen in einem Mitteldeutschen Zentrum für Ernährung und Gesundheit bündeln.

Institution: Bauhaus-Universität Weimar
Forschende: Prof. Dr.-Ing. Conrad Völker, Dr.-Ing. Hayder Alsaad, Lia Becher, Amayu Wakoya Gena
Was passiert, wenn wir husten? Wie weit reicht die Atemluft in den Raum? Und: Wirkt das Tragen eines Mund-Nasenschutzes? Was für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, ist häufig nur schwer zu begreifen. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie ist dieses Grundprinzip der Forschung jedoch aktueller denn je. Nicht selten führt gerade der Blick über den Tellerrand hierbei zu Innovation und Fortschritt. An der Bauhaus-Universität Weimar wird dieses Prinzip gelebt und weitergedacht, wie die jüngsten Forschungsarbeiten an der Professur Bauphysik beweisen.
Mithilfe der optischen Schlierenverfahren, das sind der weltweit einzigartige Schlierenspiegel sowie das Background Oriented Schlieren (BOS) Verfahren, werden selbst kleinste Luftströmungen sichtbar: Ähnlich wie bei einer überhitzten Straße im Sommer, wenn die Luft über dem Asphalt flimmert, hat die warme, feuchte Atemluft eine andere Dichte als die kühlere Raumluft. Beide Messverfahren machen diese Dichteunterschiede in einem Foto oder Videobild sichtbar.
Eingesetzt werden die Schlierenverfahren an der Professur Bauphysik der Bauhaus-Universität Weimar vornehmlich zur Erforschung des Raumklimas. Ziel ist die Entwicklung individueller Lösungen, um die Energieeffizienz von Räumen zu optimieren. Mit Aufkommen der Corona-Pandemie entstanden jedoch völlig neue Anwendungsgebiete, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von effizienten Hygiene- und Sicherheitskonzepten leisten sollen.

Institution: TU Ilmenau
Professor Eberhard Manske (m), Leiter des Fachgebiets Fertigungs- und Präzisionsmesstechnik an der TU Ilmenau erhält mit seinem Team den Thüringer Forschungspreis 2020. Der Thüringer Forschungspreis 2020 im Bereich Grundlagenforschung wurde dem Projekt „Subnanometermessverfahren höchster Präzision mit zehn Dekaden Messbereich“ der Technischen Universität Ilmenau zuerkannt.
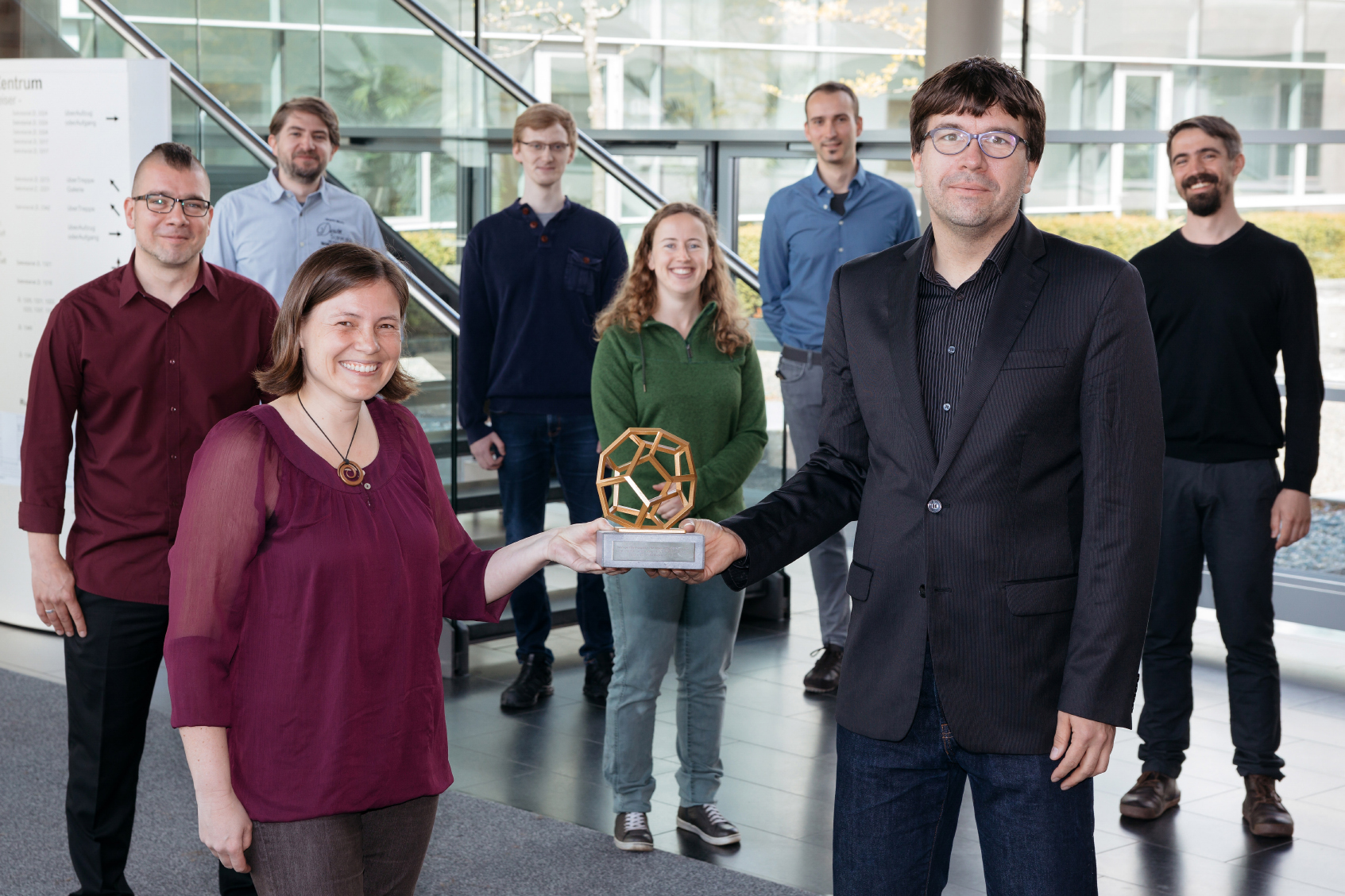
Institution: Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena
Prof. Patrick Mäder, Fachgebietsleiter Softwaretechnik für sicherheitskritische Systeme an der TU Ilmenau, und Dr. Jana Wäldchen, Gruppenleiterin Flora-Incognita-Projekt am Max-Planck-Institut Jena, erhalten mit ihren Teams den Thüringer Forschungspreis 2020. Der Thüringer Forschungspreis 2020 im Bereich „Angewandte Forschung“ erhält das Projekt „Künstliche Intelligenz revolutioniert die Pflanzenbestimmung“, einer interdisziplinäre Zusammenarbeit der Technische Universität Ilmenau und des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena.

Kategorie: Grundlagenforschung
Institutionen: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung – iDiv
Forschende: Prof. Dr. Ulrich Brose, im Bild mit Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee

Kategorie: Angewandte Forschung
Institution: Fraunhofer-IKTS Hermsdorf
Forschende: Prof. Dr. Michael Stelter, Dr. Roland Weidl, Dr. Matthias Schulz, Dipl.-Ing. Heidi Dohn-dorf, M. Sc. Martin Hofacker, M. Sc. Benjamin Schüßler, Dipl.-Ing. (FH) Lutz Kiesel, im Bild mit Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee

Kategorie: Angewandte Forschung
Institutionen: IPHT Jena / FSU Jena / UKJ
Forschende: Prof. Dr. Jürgen Popp, Prof. Dr. Ute Neugebauer, Prof. Dr. Michael Bauer, Prof. Dr. med. Bettina Löffler, Dr. Uwe Hübner, Dipl.-Ing. Peter Horbert

Kategorie: Grundlagenforschung
Institution: FSU Jena
Forschende: Prof. Dr. Lambert Wiesing, im Bild mit Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee

Kategorie: Grundlagenforschung
Institution: Leibniz Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut Jena
Forschende: Dr. Alessandro Cellerino, Prof. Dr. Christoph Englert, Dr. Matthias Platzer, Dr. Bryan R. Downie, Dr. Nils Hartmann, Dr. Philipp Koch, Dr. Andreas Petzold, Dr. Kathrin Reichwald, im Bild mit Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee

Kategorie: Angewandte Forschung
Institution: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Prof. Dr.‐Ing. habil. Thomas Fröhlich, apl. Prof. Dr.‐Ing. habil. Roland Füßl, Dr.‐Ing. Michael Kühnel, Dipl‐Ing. Gunter Krapf, Dr. ‐Ing. Falko Hilbrunner, Dr.‐Ing. Jan Schleichert, im Bild mit Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee
Thema: Entschlüsselung mehrerer Genome des Pesterregers aus Überresten mittelalterlicher Pest-Opfer
Institution: Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte
Forschende: Prof. Dr. rer. nat. Johannes Krause
Thema: Polymer-Redox-Flow-Batterie auf Basis von wässrigen Kunststofflösungen
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Center for Energy and Environmental Chemistry
Forschende: Prof. Dr. Ulrich S. Schubert, Dr. Martin Hager und Tobias Janoschka
Thema: Aufklärung einer genetisch bedingten neurodegenerativen Erkrankung, die zum Verlust von Sensibilitäts- und Schmerzempfinden führt
Institution: Institut für Humangenetik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. med. Christian Hübner und Prof. Dr. med. Ingo Kurth
Thema: Artenvielfalt schützt das Klima
Institution: Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena
Forschende: apl. Prof. Dr. agr. habil. Gerd Gleixner
Thema: Miniaturisiertes, linsenloses 3D-Mikroskop (Blood Cell Counter) für medizinische Anwendungen
Institution: -
Forschende: Dr. Rainer Riesenberg, Dr.-Ing. Mario Kanka, Dr. Alexej Grjasnow
Thema: Antibiotika aus Insektensymbiosen: Erstaunlicher Verteidigungspakt mit Bakterien
Institution: Max-Planck-Institut für chemische Ökologie
Forschende: Dr. Martin Kaltenpoth
Thema: Ultrasensitive immunologische Schnelltests für die Notfallmedizin auf Basis nanostrukturierter Polymermembranen
Institution: fzmb Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie, Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Katrin Frankenfeld, Christian Rautenberg, Dipl.-Ing. (FH) Prof. Dr. Thomas Heinze, Dr. Friedrich Scholz
Thema: Optische Fasern mit Funktion: Innovative Ziehturmtechnik zum Einschreiben von Faser-Bragg-Gittern
Institutionen: Leibniz-Institut für Photonische Technologien und FBGS Technologies GmbH
Forschende: Prof. Dr. Hartmut Bartelt, Dipl.-Phys. Manfred Rothhardt, Dr. Sonja Unger, Ing. Jens Kupis, Dr. Eric Lindner, Dipl.-Ing. Christoph Chojetzki
Thema: Untergrund der Aufklärung
Institution: Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt
Forschende: Prof. Dr. Martin Mulsow
Thema: Dreidimensionale Bilderfassung
Institutionen: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF Jena und Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Dr. Gunther Notni, Dr. Peter Kühmstedt und Prof. Dr. Richard Kowarschik
Thema: Abhörsichere Kommunikation
Institution: Technischer Universität Ilmenau
Forschende: Prof. Dr.-Ing. Günter Schäfer, Dr.-Ing. Michael Roßberg, Franz Girlich, Michael Grey und Markus Trapp
Thema: Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs
Institutionen: Universitätsklinikum der Friedrich-Schiller-Universität Jena und oncgnostics GmbH
Forschende: Prof. Dr. Matthias Dürst, Dr. Alfred Hansel, Dr. Martina Schmitz und Kerstin Brox
Thema: Religiöser Wandel in der römischen Antike
Institution: Universität Erfurt
Forschende: Prof. Dr. Jörg Rüpke
Thema: Multikontrast-Mikroskopie für den klinischen Einsatz
Institutionen: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Photonische Technologien e. V., Fraunhofer-Institut für Optik und Feinmechanik und Universitätsklinikum Jena
Forschende: Prof. Dr. Benjamin Dietzek (FSU/IPHT), Junior-Prof. Dr. Jens Limpert (FSU/IOF), Prof. Dr. med. Orlando Guntinas-Lichius (Klinikum FSU Jena), Prof. Dr. Jürgen Popp (FSU / IPHT), PD Dr. med. Bernd F. M. Romeike (Klinikum FSU Jena) Prof. Dr. med. Andreas Stallmach (Klinikum FSU Jena) Prof. Dr. Andreas Tünnermann (FSU, Fraunhofer IOF)
Thema: Erforschung des biotechnologischen Verfahrens „JenaCell“
Institution: Universität Jena
Forschende: Dr. Dana Kralisch (FSU Jena), Dr. Nadine Heßler (JeNaCell GmbH
Thema: Tiefe Lagerstättenerkundung mit JeSSY DEEP
Institutionen: Institut für Photonische Technologien e. V., Supracon AG
Forschende: Dr. Ronny Stolz, Andreas Chwala, Frank Bauer, Dr. Viatcheslav Zakosarenko, Dr. Ludwig Fritzsch (IPHT), Matthias Meyer , Michael Starkloff, Dr. Nikolai Oukhanski (Supracon AG)
Thema: Strukturaufklärung in kleinsten Dimensionen
Institution: Institut für Photonische Technologien Jena
Forschende: PD Dr. Volker Deckert (IPHT / FSU), Dana Cialla (IPHT / FSU), Dr. Tanja Deckert-Gaudig (IPHT), Dr. Henrik Schneidewind (IPHT), Dipl.-Ing. Konstantin Kirsch (IPHT)
Thema: Steuerung von Biomolekülen an Materialoberflächen – Wie die Nanostruktur von Polyethylen-Oberflächen die Proteinanordnung und -orientierung steuert
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Klaus D. Jandt, Dr. Thomas F. Keller
Thema: Entwicklung eines alternativen Material – Herstellungsverfahrens auf Pulver-Sinter-Basis für Hochleistungslaserfaser
Institution: Institut für Photonische Technologien Jena
Forschende: Dipl.-Chem. Stephan Grimm, Dipl.-Ing. Martin Leich, Dipl.-Phys. Florian Just, Dipl.-Phys. Volker Reichel
Thema: DasEntspiegelungsverfahren AR-Plas
Institution: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena
Forschende: Dr. Ulrike Schulz, Dr. Peter Munzert
Thema: Erzeugung ultrakurzer Röntgenimpulse für die Aufklärung von transienten Strukturen der Materie
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Christian Spielmann
Thema: Technologieplattform für Chip-basierten Vor-Ort-Nachweis von Mikroorganismen
Institutionen: Friedrich-Schiller-Universität, Institut für Photonische Technologien Jena, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit – Friedrich-Loeffler-Institut Jena
Forschende: Dr. Robert Möller (IPHT), Dr. Wolfgang Fritzsche (IPHT), Dr. Thomas Schüler (Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen, vorher FSU Jena), Matthias Urban (IPHT), Robert Kretschmer (FSU Jena), Christian Seyboldt (Friedrich-Loeffler-Institut, Jena)
Thema: Keramische Membranen für die Sauerstoff-Erzeugung
Institution: Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme Hermsdorf
Forschende: Dr. Ralf Kriegel, Dr. Ingolf Voigt, Dr. Jürgen Böer, Dipl.-Ing. Lutz Kiesel, Dipl.-Ing. Matthias Schulz
Thema: Beschreibung und Analyse neuronaler Korrelate der Gesichtserkennung
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Stefan R. Schweinberger, Dr. Jürgen M. Kaufmann, Dr. Holger Wiese
Thema: Terahertz-Sicherheitskamera
Institution: Institut für Photonische Technologien Jena, Jena-Optronik, Supracon AG
Forschende: PD Dr. Hans-Georg Meyer, Dr. Viatcheslav Zakosarenko, Dr. Solveig Anders, Torsten May, Marco Schulz, Dr. Günter Thorwirth, Michael Starkloff
Thema: Neuartigen Wirkstoff gegen hochresistente Tuberkulose
Institutionen: Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena, A. N. Bakh-Institut für Biochemie Moskau
Forschende: Dr. Ute Möllmann, Dr. Vadim Makarov
Thema: Interaktiver, mobiler Shopping-Roboter
Institutionen: Technische Universität Ilmenau, MetraLabs GmbH Ilmenau
Forschende: Prof. Horst-Michael Groß, Prof. Hans-Joachim Böhme, Dr.-Ing. Christoph Schröter, Dipl.-Inf. Alexander König, Dipl.-Inf. Steffen Müller Dipl.-Inf. Erik Einhorn Dr. rer. pol. Andreas Bley, Dipl.-Inf. Christian Martin, Dipl.-Ing. Matthias Merten, Dipl.-Inf. Johannes Trabert (MBA), Dipl.-Ing. Norbert Herda, Dipl.-Ing. Rüdiger Scheidig Dipl.-Inf. Tim Langer
Thema: Numerische Simulation turbulenter Konvektionsströmungen
Institutionen: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Prof. Dr. Jörg Schumacher
Thema: Neue Wege in der Sepsisforschung
Institution: Friedrich-Schiller- Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Konrad Reinhart
Thema: Entwicklung einer Technologie zur galvanischen und elektrochemischen Modifizierung von vorstrukturierten partiell leitfähigen textilen Flächen zur Integration von Mikrosystemtechnik in Textilien
Institution: Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland
Forschende: Dr. rer. nat. habil. Andreas Neudeck
Thema: Entwicklung und Implementierung der Direkteinarbeitung von Phasenwechselwerkstoffen in Polymermatrizes
Institution: Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung Rudolstadt
Forschende: Dr.-Ing. Ralf-Uwe Bauer, Dr. rer. nat. Axel Kolbe, Dr. rer. nat. Marcus Krieg, Dr. rer. nat. Frank Meister, Dipl.-Ing. Jürgen Melle, Dipl.-Ing. Michael Mooz
Thema: Molekulare Steuerung von Proteinen und das Schaltverhalten von Ionenkanälen
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. med. Klaus Benndorf
Thema: Steigerung der Lebenserwartung durch oxidativen Stress
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. med. Michael Ristow
Thema: Komponenten und Systeme für die EUV-Lithographie bei 13,5 nm
Institution: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena
Forschende: Dr. rer. nat. Torsten Feigl, Sergiy Yulin, Dr. rer. nat. Uwe Zeitner, Dr. rer. nat. Thomas Peschel, Dipl.-Phys. Sven Schröder, Dipl.-Ing. (FH) Christoph Damm, Dipl.-Ing. (FH) Tino Benkenstein
Thema: Eine neue Tumorsuppressor-Kaskade
Institution: Leibniz-Institut für Alternforschung – Fritz-Lipmann-Institut Jena
Forschende: Dr. Helen Morrison
Thema: Beschleunigung – Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Hartmut Rosa
Thema: Entwicklung eines berührungslosen Strömungsmessverfahrens für Hochtemperaturschmelzen
Institution: Technische Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. André Thess, Prof. Dr. Yurii Kolesnikov, PD Dr.-Ing. Christian Karcher, Dr. Evgeny Votyakov
Thema: MIMO – Channel-Sounder-Meßsystem
Institution: Technische Universität Jena
Forschende: Prof. Reiner Thomä, Prof. Tad Matsumoto, Dr.-Ing. Andreas Richter, Dipl.-Ing. Christian Schneider, Dipl.-Ing. Markus Landmann, Dipl.-Ing. Gerd Sommerkorn, Dipl.-Ing. Uwe Trautheim
Thema: Bakterielle Endosymbionten
Institution: Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena
Forschende: Prof. Dr. Christian Hertweck, Laila P. Partida-Martinez
Thema: Diskriminierung und Toleranz zwischen sozialen Gruppen
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Amélie Mummendey, Prof: Dr. Thomas Kessler, PD Dr. Thorsten Meiser, PD Dr. Kai Sassenberg
Thema: Mikroreaktorik für High-Throughput-Einzelzellkultivierungen von Mikroorganismen
Institutionen: Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik Heiligenstadt, Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena, Institut für Physikalische Hochtechnologie Jena, Technische Universität Ilmenau
Forschende: Dr.-Ing. Josef Metze, Dr. Karen Lemke, Dipl.-Ing. Andreas Grodrian (iba), Dipl.-Biol. Karin Martin, Dr. Martin Roth (HKI), Dr. Thomas Henkel (IPHT), Prof. Michael Köhler (TUI)
Thema: Qubits für skalierbare Quantenrechner
Institution: Institut für Physikalische Hochtechnologie Jena
Forschende: Prof. Miroslaw Grajcar, Dr. Evgeni Ilichev, Andrei Izmalkow, Dr. Thomas Wagner
Thema: Bakterielle Symbionten als Wirkstoffproduzenten aus Tieren
Institution: Max-Planck-Institut für chemische Ökologie Jena
Forschende: Prof. Dr. Jörn Piel
Thema: Ultraflachen Kamera (Künstliches Insektenauge)
Institution: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena
Forschende: Dr. Andreas Bräuer, Dr. Peter Dannberg, Dipl.-Ing. Jacques Duparré, Dr. Peter Schreiber
Thema: Hochintensitätslaser
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Roland Sauerbrey, Dr. Heinrich Schwoerer
Thema: Eine mögliche präbiotische Bildung von Ammoniak aus molekularem Stickstoff auf Eisensulfidoberflächen
Institutionen: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena
Forschende: Prof. Dr. Wolfgang Weigand (FSU), Prof. Dr. Günther Kreisel (FSU), Dr. Willi Brand (MPI)
Thema: Hämolytische Urämische Syndrom
Institutionen: Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Peter Zipfel
Thema: Wellenfeldsynthese-Technologie
Institution: Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie Ilmenau
Forschende: Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg, Dr.-Ing. Sandra Brix, Dr.-Ing. Thomas Sporer
Thema: Mikrostrukturierte dielektrische Filter für Farbsensoranwendungen
Institution: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena
Forschende: Dipl.-Ing. Wolfgang Buß, Dr. rer. nat. Ramona Eberhardt, Dr. rer. nat. Marcus Frank, Dipl.-Ing. Matthias Mohaupt, Dipl.-Phys. Hein Uhlig
Thema: Arbeiten über die Funktionsweise von Ionenkanal-Proteinen
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Stefan Heinemann
Thema: Micro- and Nano-Scaled Photonics
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Dr. Ernst-Bernhard Kley, Dr. Stefan Nolte, Dr. habil. Ulf Peschel, Dipl.-Ing. Thomas Pertsch
Thema: Entwicklung eines neuartigen Nanopositionier- und Nanomessverfahrens
Institutionen: Technische Universität Ilmenau, Zentrum für Bild und Signalverarbeitung Ilmenau, SIOS GmbH
Forschende: Prof. Dr.-Ing. Gerd Jäger, Dr.-Ing. Eberhard Manske, Dr.-Ing. Tino Hausotte, Dr.-Ing. Walter Schott, Dr.-Ing. habil. Karl-Heinz Franke, Dipl.-Ing.Torsten Machleidt
Thema: Organisation und Funktion des Gehirns, Bewegungsfunktionstherapie, neue Rehabilitationsmethoden und deren Wirksamkeit
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Wolfgang Miltner
Thema: Entwicklung miniaturisierter Hochleistungsspektrometer
Institution: Institut für Physikalische Hochtechnologie e. V., Jena
Forschende: Dr. Rainer Riesenberg
Thema: Entwicklung und Transfer des High-Speed-3-D-Digitalisierers für CAD / CAM in der Zahnmedizin und Industriedigitalisierung
Institution: Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik Jena
Forschende: Dr. Gunther Notni, Peter Kühmstedt, Dr. Jörg Gerber
Thema: Mengers Theorem
Institution: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Dipl.-Math. Frank Göring
Thema: Macrophage Infectivity Potentiator Protein zur Analyse der Struktur des Erregers der Legionärskrankheit
Institution: Institut für Molekulare Biotechnologie Jena
Forschende: Dr. Alan Riboldi-Tunnicliffe
Thema: BASIC – Bacterial Synthesized Cellulose
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Dieter Klemm, Prof. Dr. Dieter Schumann, Dipl.-Chem. Ulrike Udhardt, Dipl.-Biol. Sylvia Marsch
Thema: Chromatographische Festphasen-Extraktion (SPE) zur Generierung von Testproben aus der Natur für das Hochdurchsatzscreening
Institutionen: Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena, CyBio Screening GmbH
Forschende: Dr. Isabel Sattler, Prof. Dr. Susanne Grabley, Dr. Ingrid Schmidt, PD Dr. Ralf Thiericke, Thomas Moore, Dr. Gert Ebert, Dipl.-Ing. Michael Berg
Thema: Recht der Europäischen Integration
Institution: Friedrich-Schiller-Universität
Forschende: Prof. Dr. Peter M. Huber
Thema: Entdeckung und Charakterisierung von protoplanetaren Akkretionsscheiben
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Prof. Dr. Thomas Hennig
Thema: Physik der Jets junger Sterne
Institution: Thüringer Landessternwarte Tautenburg
Forschende: Dr. Jochen Eislöffel
Thema: Optische Mikromanipulation auf Zweiphotonen-Anregung vitaler Zellen mittels NIR-Mikroskopie
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: PD Dr. Karsten König
Thema: Feinzielsensors für Geodätische Vermessungsgeräte
Institutionen: Technische Universität Ilmenau, Carl Zeiss Jena GmbH
Forschende: Prof. Gerhard Linß, Dr. Peter Brückner, Dipl.Ing. Christian Usbeck, Dipl.-Ing. Holger Klose, Dr. Ludwin Monz, Dipl.-Ing. Marcel Seeber, Ing. Helmut Schreiber
Thema: Micro Offset Printing – eine universelle Biochip-Technologie
Institutionen: CLONDIAG chip technologies GmbH, Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena, Institut für Physikalische Hochtechnologie Jena
Forschende: E. Ermantraut, Dr. Thorsten Schulz, Dr. Stefan Wölfl
Thema: Molekulare Basis der Symbiose zwischen Rhizobium und Leguminosen
Institution: Institut für Molekulare Biotechnologie Jena
Forschende: Dr. Christoph Freiberg, Prof. Dr. André Rosenthal
Thema: Neurophysiologisch motivierte Architektur zur Erzeugung stabiler Farbpräsentationen
Institution: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Dr.-Ing. Torsten Pomierski
Nicht vergeben
Thema: Entwicklung einer Familie thermoelektrischer Mikrosensoren
Institution: Institut für Physikalische Hochtechnologie Jena
Forschende: Jürgen Müller, Volker Baier, Dr. Ulrich Dillner, Rudolf Gütich, Dr. Ernst Kessler,Siegfried Poser
Thema: Herstellungsverfahren für ein gentechnisches Arzneimittel
Institution: Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena
Forschende: Prof. Dr.-Ing. Hans-Dieter Pohl
Thema: Identifizierung und Charakterisierung von Antagonisten der Zellproliferation
Institution: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Forschende: Dr. rer. nat. habil. Frank Dietmar Böhmer
Thema: Digitales optisches asynchrones CDMA-System mit Polarisationsmodulation und optisches CDMA im Teilnehmeranschlußbereich
Institution: Technische Universität Ilmenau
Forschende: Dipl.-Ing. Kay Iversen